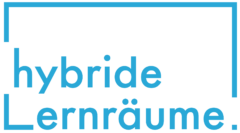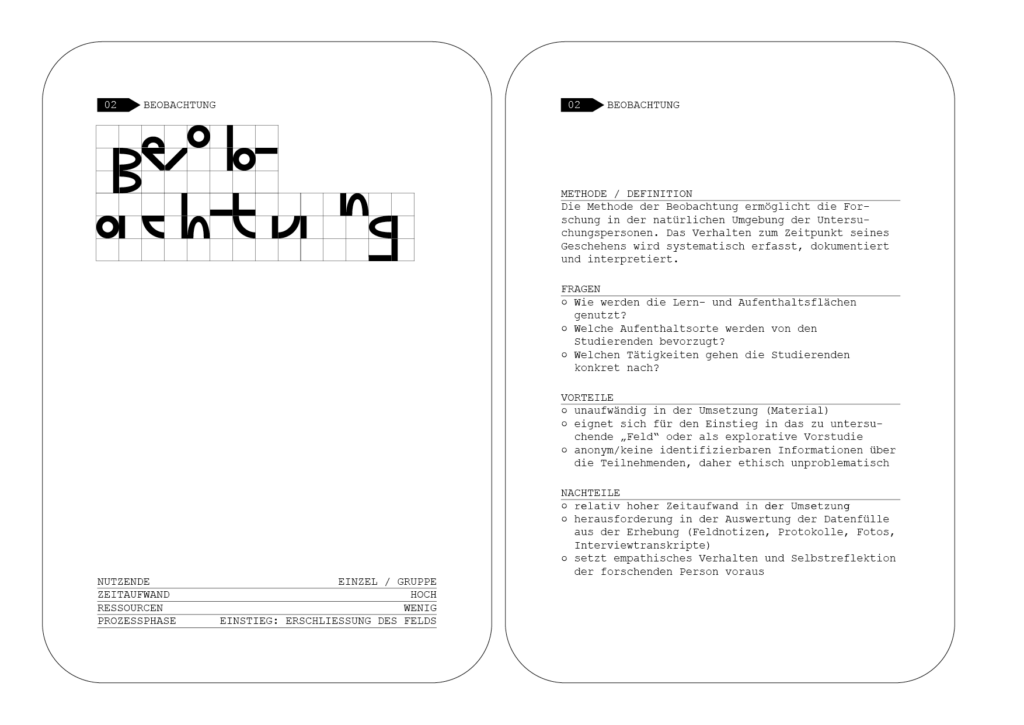
Die Methode der Beobachtung ermöglicht die Forschung in der natürlichen Umgebung der Untersuchungspersonen und des Aktanten. Verhalten zum Zeitpunkt seines Geschehens wird systematisch erfasst, dokumentiert und interpretiert (vgl. ATTESLANDER 2008, S. 67). Diese Methode gilt als Standardmethode der Feldforschung.

>> Zurück zur Methodenübersicht
Ziele
Bei der Beobachtung geht es um das Kennenlernen der Alltagswirklichkeiten, im Kontext Lernraum – der Lernenden, der Lernaktivitäten sowie der Lernumgebungen und Lerninfrastrukturen.
Fragestellungen
○ Wie werden die Lern- und Aufenthaltsflächen genutzt?
○ Welche Aufenthaltsorte werden von den Studierenden bevorzugt?
○ Welchen Tätigkeiten gehen die Studierenden konkret nach?
○ Wie wird der Aktant genutzt und eingesetzt?
○ Was fehlt? Was ist überflüssig? (vgl. POTH, 2018)
Beschreibung zur Umsetzung
Für eine Beobachtungsstudie müssen Untersuchungsdesign und Umsetzung sorgfältig geplant sein. Bei der Auswahl sind – neben der Rolle der Beobachtenden (z. B. teilnehmend, nichtteilnehmend) – folgende Aspekte zu beachten:
○ Beobachtungsorte und Beobachtungszeiten: Wo, wann und unter welchen Rahmenbedingungen wird beobachtet? Wann und wie lange soll beobachten werden?
○ Beobachtungsobjekte: Welche Personen, welche Gruppen, Ereignisse oder Gegenstände sollen beobachtet werden?
○ Beobachtungseinheiten: Welche konkreten Aspekte der Beobachtungsobjekte (z. B. welche Eigenschaften, Verhaltensweisen) sollen hinsichtlich ihrer Qualität, Häufigkeit oder Intensität beobachtet werden?
Umgekehrt: Was ist für die Studie unwesentlich und kann ignoriert werden? (vgl. DÖRING und BORTZ 2016, S. 326)
Die Beobachtung kann qualitativ oder quantitativ ausgerichtet sein.
○ Bei der teilnehmenden Beobachtung werden die Nutzenden in einem definierten Bereich des Raums gezählt, während eine Reihe von Verhaltensvariablen der Nutzenden (z. B. vorhandene Technologie, genutzte Möbel, usw.) in zeitlichen Intervallen über eine festgelegte Anzahl von Tagen, Wochen oder mehr erfasst werden (vgl. REGALADO und SMALE 2018, S. 21).
○ Es können sowohl qualitative Beobachtungsdaten [z.B. visuelle Daten (Fotos), verbale Daten (Feldnotizen)] erhoben werden, als auch quantitative bzw. numerische Beobachtungsdaten (Messwerte) (z.B. Häufigkeiten und Intensitäten von bestimmten Verhaltensmustern)(vgl. DÖRING und BORTZ 2016, S. 324).
Die Datenerhebung erfolgt durch Feldnotizen oder Beobachtungprotokolle. Die Beobachtung kann durch informelle Interviews (spontan und offen) ergänzt werden (vgl. GIRTLER 2001, S. 146).
| Vorteile | Nachteile |
| ○ unaufwändig in der Umsetzung (Material) ○ Eignet sich für den Einstieg in das zu untersuchende „Feld“ oder als explorative Vorstudie. ○ anonym/keine identifizierbaren Informationen über die Teilnehmenden, daher ethisch unproblematisch. ○ „Eine Beobachtung kann non-reaktiv (d. h. nichtteilnehmend und verdeckt) stattfinden, so dass nicht in die natürlichen Abläufe eingegriffen wird.“(vgl. DÖRING und BORTZ 2016, S. 325) | ○ relativ hoher Zeitaufwand in der Umsetzung ○ Herausforderung in der Auswertung der Datenfülle aus der Erhebung (Feldnotizen, Protokolle, Fotos, Interviewtranskripte) ○ Setzt empathisches Verhalten und Selbstreflexion der forschenden Person voraus. ○ „Viele subjektive Erlebensphänomene sind einer Fremdbeobachtung nicht zugänglich (Grenzen der Beobachtbarkeit) und müssen erfragt werden.“(vgl. DÖRING und BORTZ 2016, S. 325) |
Quellen
○ ATTESLANDER, Peter, 2008. Methoden der empirischen Sozialforschung. 12., durchges. Aufl. Berlin: Erich Schmidt. ISBN 978-3-503-10690-5
○ DÖRING, Nicola, 2023. Datenerhebung. In: Nicola DÖRING (Hrsg.), Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften [online]. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 321–570. [Zugriff am: 27 Mai 2024]. ISBN 978-3-662-64762-2. Verfügbar unter: https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2_10
○ GIRTLER, Roland, 2001. Methoden der Feldforschung [online]. 4. neu bearb. Aufl. Böhlau Verlag Wien. ISBN 978-3-8385-2257-9. Verfügbar unter: https://www.utb.de/doi/book/10.36198/9783838522579
○ POTH, Daniela, 2018. Der „Digital Creative Space“ der SUB Göttingen – eine Experimentierfläche. [online]. Präsentationsfolien. Göttingen. 24 Oktober 2018.
[Zugriff am: 27 März 2024]. Verfügbar unter: https://dini.de/fileadmin/ag/lernraeume/DigitalCreative-Space_SUB_Goettingen_Poth.pdf
○ REGALADO, Mariana und Maura SMALE, 2018. Academic Libraries for Commuter Students: Research-Based Strategies [online]. Ala Editions. ISBN 978-0-8389-1736-7. Verfügbar unter: https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=bc_pubs