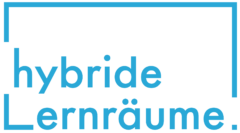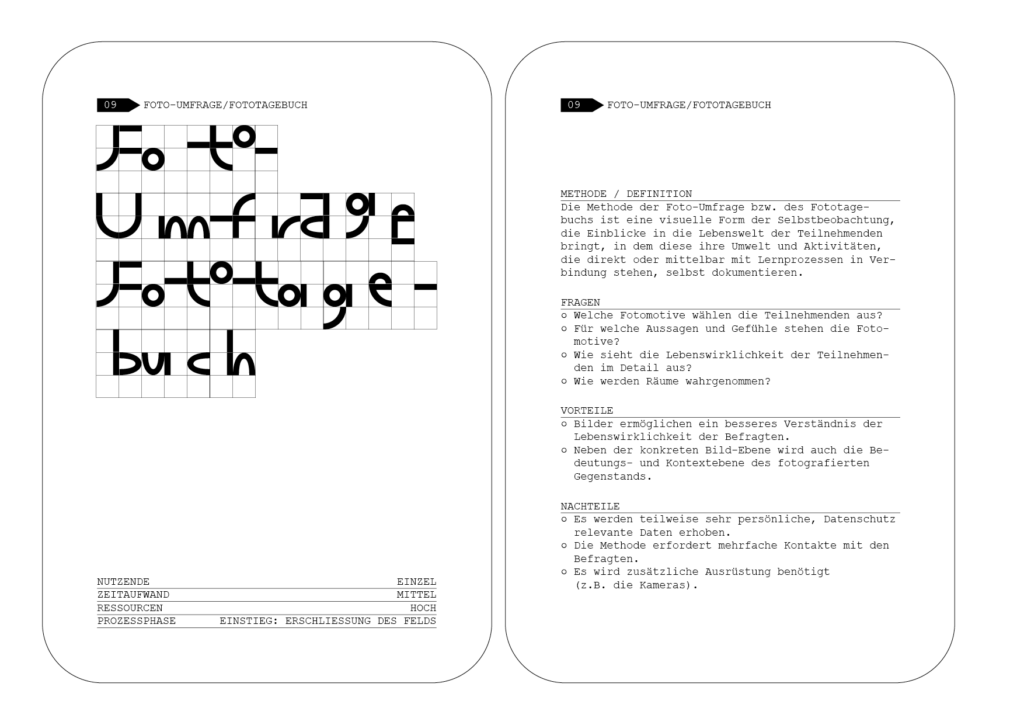
Eine Foto-Umfrage bzw. ein Fototagebuch ist eine partizipative Forschungsmethode, bei der die Teilnehmenden ihre Umwelt und Aktivitäten, die direkt oder mittelbar mit Lernprozessen in Verbindung stehen, dokumentieren. Auf diese Weise können visuelle Eindrücke der Lebenswelt der Untersuchungspersonen gesammelt werden.

>> Zurück zur Methodenübersicht
Ziele
Bei der Foto-Umfrage/dem Fototagebuch geht es um eine visuelle Form der Selbstbeobachtung, die erweiterte Einblicke in den Lebens- und Lernalltag der Teilnehmenden bringt.
Fragestellungen
○ Welche Fotomotive wählen die Teilnehmenden aus?
○ Für welche Aussagen und Gefühle stehen die Fotomotive?
○ Wie sieht die Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden im Detail aus?
○ Wie werden Räume wahrgenommen?
○ Welche Elemente des Raumes werden durch die Teilnehmenden dargestellt und beschrieben? Welche Bedeutung haben sie für sie? (vgl. NEUROHR und BAILEY 2016, S. 58)
Beschreibung zur Umsetzung
Für Foto-Umfragen/Fototagebücher können Themen oder Fragen vorgegeben werden, wie zum Beispiel die Frage nach Lieblingsplätzen in der Hochschule, nach Materialien, die mitgenommen werden oder nach Orten, die negative Gefühle hervorrufen, dadurch kann die Vorgehensweise sehr strukturiert oder sehr offen angelegt werden. Den Teilnehmenden wird entweder eine Kamera geliehen, mit der sie in einem festgelegten Zeitraum Fotos machen (vgl. ASHER und MILLER 2011, S. 13ff) oder sie nutzen ihr eigenes Smartphone/ihre Kamera, um ihr Umfeld zu fotografieren. Die aufgenommenen Fotos können in einem anschließenden Interview kommentiert und bewertet werden.
| Vorteile | Nachteile |
| ○ Bilder ermöglichen ein besseres Verständnis der Lebenswirklichkeit der Befragten ○ neben der konkreten Bild-Ebene wird auch die Bedeutungs- und Kontextebene des fotografierten Gegenstands (vgl. BRIDEN 2007, S. 40) ○ die visuelle Methoden kann die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit der Befragten schulen/verbessern (vgl. NEUROHR und BAILEY 2016, S. 57) | ○ Es werden teilweise sehr persönliche, Datenschutz relevante Daten erhoben ○ Die Methode erfordert mehrfache Kontakte mit den Befragten ○ Es wird zusätzliche Ausrüstung benötigt (z.B. die Kameras) ○ zu große zeitliche Abstände zwischen dem Aufnehmen der Fotos und dem retrospektiven Interview können bei den Befragten zu Erinnerungslücken in Bezug auf den Gegenstand/Kontext der Aufnahme führen (vgl. BRIDEN 2007, S. 45) |
Practices
Beispiel 1: Die Foto-Umfrage wurde beim Undergraduate Research Project an der River Campus Libraries, Universität von Rochester genutzt, um Einblick in die Lebenswelt der Untersuchungsgruppe (= Studierende) zu gewinnen und so leichter mit ihnen ins Gespräch zu kommen (vgl. BRIDEN 2007, S. 40 ff).
Auch im ERIAL-Project (vgl. ASHER und MILLER, 2011) und im „Undergraduate Scholarly Habits Ethnography Project“ der City University New York CUNY wurde intensiv mit der Methode des Photo Diaries gearbeitet (vgl. UNIVERSITY OF NEW YORK, 2021).
Beispiel 2: Das Methodenvideo “Photo Survey” zeigt eine praktischen Anwendung im Kontext der HAW Hamburg.
Quellen
○ ASHER, Andrew und Susan MILLER, 2011. So You Want to Do Anthropology in Your Library? or A Practical Guide to Ethnographic Research in Academic Libraries [online]. März 2011. Verfügbar unter: https://www.erialproject.org/wp-content/uploads/2011/03/Toolkit-3.22.11.pdf
○ BRIDEN, Judi, 2007. Photo Surveys: Eliciting More Than You Knew to Ask For. In: Susan GIBBONS und Nancy Fried FOSTER (Hrsg.), Studying Students: The Undergraduate Research Project at the University of Rochester [online]. Association of College & Research Libraries. ISBN 978-0-8389-8437-6. Verfügbar unter: http://hdl.handle.net/1802/7520
○ CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, 2018. Project Design. Undergraduate Scholarly Habits Ethnography Project [online]. 2018. Verfügbar unter: https://ushep.commons.gc.cuny.edu/project-design/
○ NEUROHR, Karen A. und Lucy E. BAILEY, 2016. Using Photo-Elicitation with Native American Students to Explore Perceptions of the Physical Library. Evidence Based Library and Information Practice. 20 Juni 2016. Bd. 11, Nr. 2, S. 56–73. DOI 10.18438/B8D629